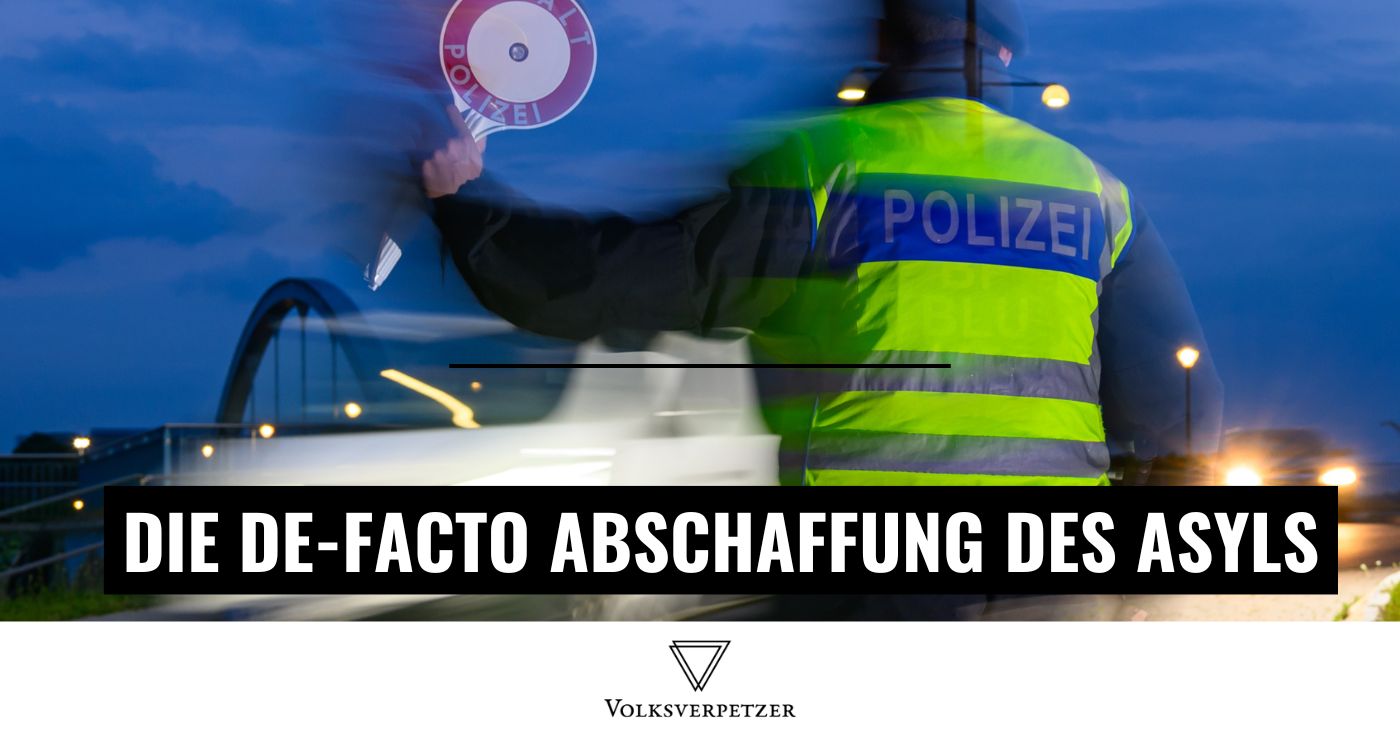Autor: Constantin Hruschka. Dieser Artikel erschien zuerst bei Verfassungsblog unter der Überschrift „Der Plan von der Abschaffung des Asyls. Vom Schutzrecht zur Fiktion“. Überschrift und Zwischenüberschriften ergänzt durch Volksverpetzer.
Peter Høegs Roman Der Plan von der Abschaffung des Dunkels, dem dieses Editorial seinen Titel verdankt, beschreibt ein System, das Menschen verbessern will, indem es sie kontrolliert. Von außen betrachtet scheint das mit dem deutschen Asylgrundrecht nichts zu tun zu haben. Dieses Recht scheint unerschütterlich: im Grundgesetz verankert als Lehre aus der millionenfachen Verfolgung und Ermordung eigener Staatsangehöriger durch Nazi-Deutschland, geboren aus dem Wissen, dass Staaten Grenzen nicht schließen dürfen, wenn Menschen um ihr Leben fliehen.
Im politischen Alltag erleben wir allerdings die Abschaffung des Asyls, ohne das Asylrecht formell zu streichen. Das Asylrecht bleibt als symbolische Garantie bestehen, während der Zugang dazu systematisch durch rigide Maßnahmen immer weiter eingeschränkt und teilweise versperrt wird.
Vom Recht zur Ausnahme
Das Asylrecht war die moralische Quintessenz der Nachkriegszeit: „Jedermann hat das Recht, in anderen Ländern Asyl zu suchen und zu genießen“, heißt es in Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dieser Anspruch ist in der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) völkerrechtlich verbürgt. Die Lehre aus dem System der Konzentrationslager generell und insbesondere aus der Shoah war, dass das Asylrecht wertlos wird, wenn es nicht erreichbar ist („zu suchen“) und keine durchsetzbaren Rechte mit sich bringt („zu genießen“). Außerdem muss es verfahrensrechtlich operationalisiert werden, mit einem Recht auf ein faires und effizientes Verfahren. Aus diesen Erwägungen findet sich im Grundgesetz der Satz: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“
In der politischen Diskussion setzt sich dagegen zunehmend ein anderes Verständnis durch: das Recht, Asyl zu verweigern, das angeblich aus Gründen der staatlichen Souveränität erforderlich sein soll. Seit Jahren verengt sich die deutsche und europäische Asylpolitik auf die Kunst der Verhinderung. Der rechtliche Anspruch bleibt bestehen, wird aber mit Verfahrenshürden, Zuständigkeitsfiktionen und politischen Mythen entkernt. Ein Beispiel ist der sogenannte Asylkompromiss von CDU/CSU, FDP und SPD aus dem Jahr 1992. Seither soll ein Asylantrag als unzulässig gelten, wenn die antragstellende Person über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland eingereist ist. Damit wurde das grundgesetzliche Asylrecht durch verfahrensrechtliche Beschränkungen entkernt und weitgehend abgeschafft – während man sich weiterhin zum individuellen Recht auf Asyl bekennt. Diese Diskrepanz zwischen theoretischem Schutz und tatsächlicher (Un-)Erreichbarkeit ist kein Nebeneffekt, sondern das Muster der Gegenwart.
Zugang zum Schutz außerhalb des Grundgesetzes
Die verfahrensrechtliche Entkernung des Asylgrundrechts hat jedoch (bisher noch) nicht dazu geführt, dass Flüchtlingsschutz und humanitärer Schutz massiv eingeschränkt werden. Vielmehr gewährt Deutschland weiterhin Schutz im Asylverfahren – allerdings im Wesentlichen basierend auf in nationales Recht transformierten völker– und unionsrechtlichen sowie europäischen Vorgaben. Mit der Umsetzung des – auf der GFK beruhenden – Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) verschwanden auch die Statusunterschiede weitgehend. So führt die Schutzgewährung in den allermeisten Fällen auch dazu, dass die betroffenen Personen den zuerkannten Schutz „genießen“, also Rechte daraus ableiten können. Bis heute haben Personen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, faktisch auch in aller Regel Zugang zu einer inhaltlichen Prüfung.
Dublin-Verfahren und GEAS
Dieser Zugang wird in einer Vielzahl von Fällen durch ein vorgeschaltetes Zuständigkeitsbestimmungsverfahren („Dublin-Verfahren“) verzögert, aber (bisher) – trotz der symbolisch stark aufgeladenen Zurückweisungen an den deutschen Binnengrenzen – nicht systematisch verweigert. Denn in diesen Fällen kommt es häufig nicht zu einer Überstellung in den zuständigen Staat. Deswegen gilt das System im politischen Raum häufig als „dysfunktional“. Diese weitverbreitete (und falsche) Vorstellung verliert die systemische Gerechtigkeit aus dem Blick. So hat etwa Deutschland im Verhältnis zu seiner Wirtschaftskraft und Bevölkerungszahl nicht überproportional viele Asylsuchende aufgenommen, wie der aktuelle Migrationsbericht der EU von dieser Woche zeigt.
Auch die EU-Kommission hat die angebliche Dysfunktionalität des Dublin-Systems im Zuge der Reformvorschläge zum GEAS aufgenommen. Spätestens seit den Kommissionsvorschlägen aus dem Jahr 2016 hat der Fokus auf die Verhinderung des Zugangs zu einer inhaltlichen Prüfung des Schutzbedarfs wieder Hochkonjunktur. Die Reformvorschläge betonen besonders das Ziel, Asylmigration aus den Außengrenzstaaten in die Mitte Europas (gelabelt als „Sekundärmigration“) zu bekämpfen. Dies verleiht Zugangsbeschränkungen zum Asylsystem neue Legitimität. Ihren sichtbarsten Ausdruck findet sie in den Binnengrenzkontrollen, die eine solche Migration verhindern sollen.
Auch im ab 2026 anzuwendenden reformierten GEAS finden wir viele Tendenzen zur Abschaffung des Asyls. Auch hier werden keine Schutzgewährungsnormen gestrichen, sondern Zugangsbarrieren auf rechtlicher und tatsächlicher Ebene errichtet. Da die innereuropäische Verlagerung bei den Staaten, auf die die Zuständigkeit verlagert werden soll, auf wenig Gegenliebe stößt, bemühen sich nationale und europäische Akteure darum, „sichere Drittstaaten“ zu konstruieren und die Verantwortung auf diese zu verlagern. Das Wunschergebnis vieler europäischer Regierungen wäre eine Rechtssphäre, in der die Garantie des Asylrechts formal noch besteht, aber andere Staaten den Schutz gewährleisten.
Das Asylrecht, das einst Ausdruck einer kollektiven Selbstverpflichtung war, droht in einem solchen System zur juristischen Simulation zu werden.
Der Mythos der „Migrationswende“
Politiker sprechen aktuell gern von der „Migrationswende“. Tatsächlich ist die Wende längst vollzogen, sie spiegelt sich in der Hyperaktivität der Gesetzgebung, die selbst das Recht destabilisiert. Über 100 Änderungen im Aufenthalts- und Asylrecht gab es binnen zehn Jahren. Die Änderungen werden meist präsentiert als Rettung des Rechtsstaats. In Wirklichkeit sind sie jedoch, soweit sie nicht Fachkräfte betreffen, vor allem Verschärfungen, die ein restriktiveres, misstrauischeres System schaffen. Ein Rechtsstaat, der sich permanent neu erfindet, verliert seine innere Ruhe.
Diese Entwicklung folgt einer spezifischen politischen Logik. Die mediale und politische Verarbeitung der „Kölner Silvesternacht“ hat gemeinsam mit den europäischen Entwicklungen – die sich in den ersten Reformvorschlägen zum GEAS und im sogenannten EU-Türkei-Deal spiegeln – in Deutschland zu einer „Migrationswende“ geführt, die spätestens im Jahr 2016 einsetzte und sich seither radikalisiert hat. Das deutsche Asylrecht befindet sich seitdem in einem Zustand permanenter Übersteuerung. Die mehr als hundert Gesetzesänderungen in zehn Jahren formulierten regelmäßig den Anspruch, „Ordnung“ und „Kontrolle“ wiederherzustellen und die „Steuerung und Begrenzung von Migration“ zu erreichen. Sie zielten nicht nur darauf, Abschiebungen in Herkunftsländer zu erleichtern, sondern wollten auch den Zugang zum Schutzrecht in Deutschland weiter erschweren.
Ohne auf die Effekte der Änderungen zu warten oder diese zu evaluieren, wurden ständig neue Regelungen erlassen. Häufig reagierten die neuen Regelungen auf Anschläge oder parlamentarische Diskussionen und wurden in Schnellverfahren beschlossen. Diese Simulation von Handlungsfähigkeit hat in ihrer atemlosen Folge von ständigen Änderungen die rechtsanwendenden Behörden auf der Landesebene fast völlig aus dem Blick verloren. In Wahrheit ist sie Rechtshyperaktivität als Ersatz für Steuerung. Das Asylrecht wird zum Ermüdungsprodukt. Es wird – wenn überhaupt – nur noch von Spezialist*innen verstanden. Wer das Asylverfahrensrecht und Zugangsbeschränkungen nicht mehr kennt, kann sich nicht auf das Schutzrecht berufen. Diese Zugangsbeschränkung ist kein Kollateralschaden, sondern Teil der Strategie.
Diese Strategie soll nicht primär Defizite beseitigen, sondern Handlungsfähigkeit symbolisieren – man „tut etwas“ gegen Kontrollverlust, gegen „illegale Migration“, gegen den imaginierten Missbrauch. So entsteht ein paradoxes System, in dem das Recht zum Vehikel seiner eigenen Erosion wird.
Wer Gesetze im Monatsrhythmus ändert, macht den Rechtsstaat nicht handlungsfähig, sondern unkenntlich.
Rhetorische Eskalation
Und auch die Rhetorik wird immer schärfer. Früher sprach man vor allem von „Vollzugsdefiziten“, heute von einem „Rechtsstaatsproblem“. Das ist bezeichnend. Nicht mehr mangelnde Umsetzung, sondern der Verlust der „Kontrolle“ und die „Gefahr für die Sicherheit“ werden beschworen. Dieser rhetorische Hebel legitimiert immer neue Eingriffe in die Grundrechte migrierender Personen, insbesondere die Zugangseinschränkungen zu einer inhaltlichen Prüfung des Schutzbedarfs.
Wenn sich die politische Sprache verschiebt und der Kontrolle, den Abschiebungen und generell der Abschreckung eine prominente politikbestimmende Rolle zuweist, dann geraten der Schutz, die menschenwürdige Aufnahme und die Verantwortungsübernahme aus dem Blick. Das Asylrecht wird so auch semantisch in eine Sicherheitsarchitektur eingepasst, die auf Effizienz, Grenzmanagement und symbolische Härte zielt und für die betroffenen Personen häufig sehr reale Gewalterfahrungen mit sich bringt. Die fortgesetzten Grenzkontrollen an den Binnengrenzen, die Zurückweisungen ohne Verfahren, die pauschalen Leistungsausschlüsse stehen paradigmatisch für diesen Weg. Sie widersprechen offen europäischem Recht und Entscheidungen des EuGH wie des EGMR.
Kalkulierter Rechtsbruch
Dieser Rechtsbruch ist kalkuliert. Er wird nicht verschwiegen, sondern häufig zumindest angedeutet oder auch offen benannt – als politisch instrumentalisierte Botschaft, dass sich die Politik von Brüssel, Luxemburg, Straßburg oder Karlsruhe keine Vorgaben machen lässt. Vielmehr möchte man so diesen Akteuren ermöglichen, ihre Position zu überdenken und zu korrigieren, um der Politik zu folgen. Dieses Vorgehen unterhöhlt die Rechtsstaatlichkeit: Es negiert das Prinzip der Bindung staatlicher Gewalt an Recht und Gesetz. Der Rechtsbruch wird zum Beweis der Souveränität. Diese spiegelt sich insbesondere in der Missachtung der Judikative und der Aufforderung an die Justiz, ihre Standards an die gefühlten Erfordernisse migrationspolitischen Handelns anzupassen.
Wenn Regierungen, die dem Grundgesetz verpflichtet sind, dessen Grundrechtsgewährleistungen für eine Gruppe zugleich systematisch rhetorisch in Frage stellen und praktisch umgehen, dann setzen sie den Rechtsstaat aufs Spiel. Wenn der Innenminister sagt, die aktuelle Migrationspolitik beruhe darauf, dass „die Bürger […] einen Politikwechsel“ erwarten, wird der Maßstab des Rechts durch den Maßstab der Mehrheitsstimmung ersetzt. Häufig, wenn politische Akteure sich auf vermeintliche gesellschaftliche Erwartungen berufen, geht es darum, rhetorisch das Recht durch die Verwendung moralischer Kategorien zu umgehen oder auszuschalten.
Die Verteidigung des Rechts gegen seine Freunde
Das Tragische an dieser Entwicklung ist, dass sie das Recht nicht nur erodiert – sondern selbst im Namen des Rechts erfolgt. Wer die Grenze zwischen Legalität und Legitimität bewusst verwischt, fördert eine Selbstbeschädigung des Rechtsstaats. Ein demokratischer Staat darf Fehler machen, er kann daran sogar scheitern. Wer aber das eigene Recht bewusst verletzt und dies als Tugend verkauft, beschädigt die Grundlage des Vertrauens, die jeden Rechtsstaat trägt.
Wenn die Migrationspolitik Rechtsverletzungen bewusst in Kauf nimmt und auf lange Verfahren vor den Gerichten hofft, dann geht es nicht mehr um Migration, sondern um die Integrität des Rechts selbst. Die Abschaffung des Asyls durch Zugangsverhinderung ist vor allem ein politisches Projekt, das die Grenzen des Rechtsstaats nicht nur austestet, sondern bewusst und systematisch überschreitet. Damit einher geht eine juristische Kulturveränderung, jedenfalls dann, wenn wir uns daran gewöhnen, dass der Rechtsbruch durch den Staat als angebliche Notwendigkeit legitim wird. So zeigt die politische Rhetorik längst juristische Wirkung. Wenn die politisch Handelnden, die Exekutive und die gesetzlichen Grundlagen für Verfahren und Leistungsgewährung Asylsuchende als „potenziell ausreisepflichtig“ konstruieren und behandeln, prägt das Entscheidungen, Akten, Urteile und vor allem die Lebensrealität der betroffenen Personen.
Die de-facto Abschaffung des Asylrechts betrifft uns alle
Dabei ist das Asylrecht der Lackmustest des Verfassungsstaats, da es Personen schützt, die politisch kaum repräsentiert sind. Wer es abschafft, schafft nicht Flüchtlinge ab, sondern verengt nur ihre ohnehin schon engen Schutzräume noch weiter. Am Asylrecht entscheidet sich, ob Recht in der oftmals vor allem rhetorisch beschworenen Krise und Überlastung standhält oder ob es zur Kulisse wird.
Diese Erosion ist nicht auf das Asylrecht beschränkt. Wer an den Außengrenzen das Recht partiell suspendiert und im Inland bestimmten Personengruppen systematisch den Zugang zum Recht erschwert, verliert die moralische Grundlage, anderswo menschenrechtliche Standards zu fördern oder gar einzufordern.
Gerade im Lichte dieser Entwicklung braucht es neben der moralischen Empörung, die das (Rechts-)Gefühl anspricht und ansprechen soll, vor allem eine neue rechtspolitische Nüchternheit. Nicht die moralische Empörung über das Elend, sondern das Beharren auf der Geltung des Rechts, auch wenn es unbequem ist, kann den Weg aus dem Dilemma weisen. Denn das Asylrecht schützt nicht nur die Geflüchteten. In seiner Ausgestaltung als Individualrecht schützt es den Rechtsstaat und die Demokratie vor sich selbst.
Der Verlust der Empathie als Rechtsproblem
Doch daneben braucht es noch etwas anderes – Empathie, diese gilt Jurist*innen oft als weiches Thema. Aber sie ist das Fundament jedes Grundrechts. Das Asylrecht setzt voraus, dass wir das Leid anderer als rechtlich relevant anerkennen. Wenn Empathie politisch diskreditiert wird, verliert das Recht seine Basis.
Die Asylpolitik der Gegenwart lebt von dieser Empathieverweigerung. Sie setzt auf Distanz, auf administrative Neutralisierung. Wer Zuständigkeits- und Zulässigkeitsregeln so ausbaut, dass bereits die Möglichkeit der Antragstellung zur Odyssee wird, stiehlt sich aus der menschenrechtlichen Verantwortung. Insofern ist die deutsche und europäische Entwicklung der Abschaffung des Asyls nicht nur ein juristischer, sondern ein anthropologischer Vorgang. Die Diskussion soll unser Bild der asylsuchenden Personen verändern. Sie werden als gefährliche Regelbrecher gelabelt und ihr Schutzbedarf dadurch unsichtbar gemacht. Diese Entwicklung ist gefährlicher als jede Verfassungsänderung. Gerade für den Schutz derer, die kaum eine Stimme haben, ist es zentral, dass das Recht und der Rechtsstaat stärker sind und bleiben als die in der aktuellen Migrationspanik kumulierte Angst.
Die Abschaffung des Dunkels
Peter Høeg beschreibt in seinem Roman ein System rigider Kontrolle, das versucht, Dunkelheit zu tilgen, und dadurch unausweichlich selbst neue Finsternis erzeugt. Ähnlich ist es auch mit der deutschen und europäischen Asylpolitik. Durch den Versuch, mittels rigider Kontrolle Ordnung und Sicherheit zu schaffen, verdunkelt sie das Grundrecht, das sie zu schützen vorgibt.
Zum Thema:
Der Artikel erschien zuerst auf verfassungsblog.de, LICENSED UNDER CC BY-SA 4.0. Überschrift und Zwischenüberschriften ergänzt durch Volksverpetzer. Verfassungsblog ist ein Open-Access-Diskussionsforum zu aktuellen Ereignissen und Entwicklungen in Verfassungsrecht und -politik in Deutschland, dem entstehenden europäischen Verfassungsraum und darüber hinaus. Er versteht sich als Schnittstelle zwischen dem akademischen Fachdiskurs auf der einen und der politischen Öffentlichkeit auf der anderen Seite.
Artikelbild: Patrick Pleul/dpa